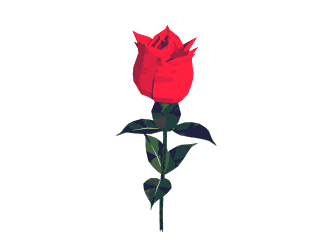Aktive Filter
- Kategorien: Wildstauden
Ihr botanischer Name Leucanthemum setzt sich aus den beiden griechischen Worten leukos was weiß bedeutet und anthemon für Blume zusammen. Wiesen-Margeritten sind Korblütler, ihre Blüten bestehen aus 20 - 25 weißen weiblichen Zungenblüten und 300 bis 400 zwittrigen, gelben Röhrenblüten. Im Garten haben Wiesen-Margeritten eine lange Blütezeit die von Mai bis in den Oktober reicht.
Wild findet man den Blutweiderich an Ufern und in Artenreichen Feuchtwiesen. Aber auch auf mäßig feuchten Böden kann man den Blutweiderich finden. Weiderich leite sich von der Ähnlichkeit der Blätter zu Weiden ab was auch für die botanische Bezeichnung salicaria = weidenartig gilt.Der Blütenstiel trägt kleine Trichterblumen, die Blütezeit ist von Juni bis September. Viele Falter lassen sich an den Blüten beobachten aber auch verschiedene Wildbienen und Schwebfliegen.
Moschus-Malven findet man an sonnigen Wegesrändern. Im Garten lieben sie trockene bis leicht feuchte Böden. Moschus -Malven lassen sich auch gut in einem nährstoffreichen Dauersubstrat in Töpfen auf Balkon und Terrasse halten. Die Trockenen Blätter duften leicht nach Moschus. Ihre Blüten werden von Bienen, Schmetterlingen und Fliegen als Nahrungsspender besucht.
Eigenschaften der Roten Lichtnelke
- Blütenpracht: Von April bis September trägt die Rote Lichtnelke zahlreiche geruchlose, kräftig rote Blüten, die jedes Gartenareal in einen lebhaften Farbenrausch verwandeln.
- Blätter und Wuchs: Die zweijährige oder mehrjährige Staude wächst als graziles Kraut mit einer Vorliebe für feuchte, kalkarme Standorte. Ihre sattgrünen, weichen Blätter bilden einen harmonischen Kontrast zu den Blüten.
- Fortpflanzung: Die Vermehrung erfolgt effizient durch Samen, die durch Windbewegung der Stängel oder treibendes Wasser verbreitet werden – eine wahre Meisterin natürlicher Anpassung!
Optimaler Standort und Bodenansprüche
Die Rote Lichtnelke gedeiht auf feuchten und kalkarmen Böden, perfekt für Naturgärten oder als Blickfang am Teichrand. Sie bevorzugt halbschattige bis sonnige Stellen und besticht durch ihre Toleranz gegenüber nährstoffärmerem Boden – eine pflegeleichte Ergänzung, die visuelle Leichtigkeit in den Garten bringt.
Bedeutung für die Tierwelt
- Bestäuberfreundlich: Die auffälligen Blüten locken eine Vielfalt an Bestäubern an, darunter Honigbienen, Wildbienen, Schmetterlinge, Hummeln und Schwebfliegen. Zwei Wildbienenarten, die Sandbiene (Andrena labiata) und die Schmalbiene (Lasioglossum morio), sammeln Pollen gezielt als Brutnahrung – ein unschätzbarer Beitrag zum Überleben dieser Arten.
- Schmetterlingsparadies: Die Blüten dienen 21 Schmetterlingsarten als Nektarquelle, darunter Klassiker wie der Aurorafalter (Anthocharis cardamines) und der Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni). Gleichzeitig nutzen Raupenarten wie Kapseleulen und Kapselspanner die Blätter als Futter.
- Lebensraum für Vögel: Die ausgereiften Fruchtstände liefern wertvolle Samen, die insbesondere von Vögeln geschätzt werden – ein lebendiges Zusammenspiel von Flora und Fauna.
Historische und praktische Anwendungen
Die Wurzeln der Roten Lichtnelke enthalten Saponine, die früher als natürliches Waschmittel verwendet wurden. Noch heute sind die Blüten, in kleinen Mengen genossen, essbar und geben dekorative Akzente in Salaten. Zudem wurde die Pflanze traditionell als Heilmittel gegen Schlangenbisse eingesetzt – ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Vielseitigkeit.
Fazit
Die Rote Lichtnelke ist nicht nur ein ästhetischer Höhepunkt für feuchte Gartenbereiche, sondern auch ein unverzichtbarer Baustein für die Förderung der Artenvielfalt. Mit ihrer langen Blütezeit und ihrer Fähigkeit, zahlreiche Bestäuber und Tiere zu unterstützen, ist sie ideal für alle, die ihren Garten in ein blühendes, nachhaltiges Paradies verwandeln möchten. Gönnen Sie Ihrem Garten etwas von der natürlichen Schönheit und dem ökologischen Wert, den die Rote Lichtnelke mit sich bringt!
Potentilla ist ein Rosengewächs und mit den Wilderdbeeren nahe verwandt. In der Natur finden sich auch Bastarde beider Arten. Der botanische Name Potentilla erhielt die Gattung wegen der Heilkraft einzelner Arten. Es wird vom lateinischen potentia was Kraft bedeutet hergeleitet. Früher wurde es gerne als Einlage in Holzschuhen gebraucht. Potentilla argentea das Silber-Fingerkraut besitzt eine silbrige Blattunterseite. Man kann es auf steinigen Wegen verwenden da es eine trittfeste und äußerst genügsame Pflanze ist. Auch für Trockenrasen ist das Silber-Fingerkraut geeignet. Trockene und nährstoffarme Böden werden toleriert. Die Blütezeit geht von Juni bis August.
Der Gamander Ehrenpreis, Veronica chamaedrys gehört zur Familie der Wegerichgewächse. Der Name Veronica stammt vermutlich aus dem lateinischen vera unica das einzig wahre ( Heilkraut ) da man der Art officinalis früher eine große Heilkraft nachgesagt hat. auch der deutsche Name Ehrenpreis kann darauf zurück geführt werden. Die Blütezeit des Gamander Ehrenpreis ist der Frühsommer von Mai bis Juni. Bestäuber sind Bienen wie die Frühlins-Pelzbiene, die Sand- und Furchenbienen aber auch Fliegen und Tagfalter. Der Gamander Ehrenpreis bildet Polster und kommt mit jedem Gartenboden zurecht. Er eignet sich auch gut für Wildrasenflächen.
Die Gattung Campanula, die Glockenblumen bilden eine eigene Familie, die Glockenblumengewächse. Der Name Campanula heißt übersetzt auch kleine Glocke und beschreibt die Form der Blüten. Die Blütezeit der Nesselblättrigen Glockenblume geht von Juli bis September. Bestäuber sind Bienen wie die Furchenbienen, Masken- und Schmalbienen aber auch Hummeln und Falter. Die Glockenblumen-Scherenbiene ist ein Spezialist und geht nur an Glockenblumen. Die Nessselblättrige Glockenblume ist auch eine schöne Schnittblume und kommt mit jedem Gartenboden zurecht.
Die Gattung Campanula, die Glockenblumen bilden eine eigene Familie, die Glockenblumengewächse. Der Name Campanula heißt übersetzt auch kleine Glocke und beschreibt die Form der Blüten. Die Blütezeit der Rundblättrigen Glockenblume geht von Mai bis Oktober. Bestäuber sind Bienen wie die Furchenbienen, Masken- und Schmalbienen aber auch Hummeln und Falter. Die Glockenblumen-Scherenbiene ist ein Spezialist und geht nur an Glockenblumen. Die Rundblättrige Glockenblume ist auch eine schöne Pflanze für Steingärten und Mauerkronen. Sie kommt mit jedem Gartenboden zurecht.
Die Gattung Campanula, die Glockenblumen bilden eine eigene Familie, die Glockenblumengewächse. Der Name Campanula heißt übersetzt auch kleine Glocke und beschreibt die Form der Blüten. Die Blütezeit der Rundblättrigen Glockenblume geht von Mai bis Oktober. Bestäuber sind Bienen wie die Furchenbienen, Masken- und Schmalbienen aber auch Hummeln und Falter. Die Glockenblumen-Scherenbiene ist ein Spezialist und geht nur an Glockenblumen. Die Rundblättrige Glockenblume ist auch eine schöne Pflanze für Steingärten und Mauerkronen. Sie kommt mit jedem Gartenboden zurecht.
Die Gattung Campanula, die Glockenblumen bilden eine eigene Familie, die Glockenblumengewächse. Der Name Campanula heißt übersetzt auch kleine Glocke und beschreibt die Form der Blüten. Die Blütezeit der Rundblättrigen Glockenblume geht von Mai bis Oktober. Bestäuber sind Bienen wie die Furchenbienen, Masken- und Schmalbienen aber auch Hummeln und Falter. Die Glockenblumen-Scherenbiene ist ein Spezialist und geht nur an Glockenblumen. Die Rundblättrige Glockenblume ist auch eine schöne Pflanze für Steingärten und Mauerkronen. Sie kommt mit jedem Gartenboden zurecht.
Eigenschaften der Tauben-Skabiose
- Blüten: Die auffälligen, großen Blütenkörbchen in strahlendem Violett ziehen alle Blicke auf sich und dienen zahlreichen Bestäubern als Nahrungsquelle.
- Blätter: Die rosettig stehenden, tiefgrünen Blätter am Boden, ergänzt durch fiederteilige Blätter weiter oben am Stängel, schaffen ein harmonisches Gesamtbild.
- Robustheit: Diese Staude ist anspruchslos, pflegeleicht und trotzt widrigen Bedingungen – perfekt für Gartenliebhaber, die sich eine unkomplizierte, ausdauernde Pflanze wünschen.
Standort und Bodenansprüche
Die Tauben-Skabiose gedeiht am besten in trockenen, kalkhaltigen Böden, wie sie typischerweise in Beeten und Steingärten vorkommen. Wichtig ist ein Standort mit guter Drainage, da sie Überschüsse an Nässe und Stickstoff nicht verträgt. Für volle Blühfreude steht sie am liebsten in sonnigen Bereichen des Gartens, wo sie mit minimalem Pflegeaufwand maximale Wirkung entfaltet.
Ökologische Bedeutung
- Bienenweide und Bestäubung: Als exzellente Bienenweide lockt die Tauben-Skabiose Wildbienen wie Sandbienen (Andrena spec.) und Furchenbienen (Halictus spec.) an. Auch die spezialisierte Skabiosen-Hosenbiene (Dasypoda argentata) und die Mauerbiene (Osmia mustelina) schätzen ihre reichhaltigen Pollen.
- Schmetterlingsparadies: Für zwei Schmetterlingsarten, darunter den Regensburger Gelbling (Colias myrmidone) und den Goldenen Scheckenfalter (Euphydryas aurinia), sind die Blätter eine wichtige Raupenfutterquelle. Zudem ziehen die Blüten Widderchen und andere Falter an.
- Nahrungsquelle: Auch andere Tiere profitieren – die ausgereiften Fruchtstände dienen Vögeln als wertvolle Futterquelle, vor allem in kargen Zeiten.
Historisches Wissen
Die Taubenblauen Blüten spiegeln sich im wissenschaftlichen Namen columbaria wider, der lateinisch auf „Taube“ verweist. Botaniker schätzen die Formenvielfalt der Staude und die hybriden Bastarde mit anderen Skabiosen, trotz deren Herausforderungen bei der Bestimmung.
Verwendung im Garten
Die Tauben-Skabiose fügt sich ideal in Naturgärten, trockene Beete und Steingärten ein. Als robuste, langlebige Pflanze mit einfacher Vermehrung durch Samen oder Ableger ist sie ideal für nachhaltig bewirtschaftete Gärten. Sie eignet sich zudem für Gärtner, die naturnahe Lebensräume schaffen möchten, ohne dabei auf Ästhetik zu verzichten.
Fazit
Die Tauben-Skabiose vereint Schönheit, Robustheit und ökologische Relevanz. Sie lockt Bienen, Schmetterlinge und andere Arten an und trägt erheblich zum Erhalt heimischer Biodiversität bei. Mit ihrem pflegeleichten Charakter und ihren beeindruckenden Blüten ist sie ein Gewinn für jeden Naturfreund und Gartenliebhaber – eine charmante und wertvolle Bereicherung, die Natur und Mensch gleichermaßen zugutekommt.
Die Gattung Campanula, die Glockenblumen bilden eine eigene Familie, die Glockenblumengewächse. Der Name Campanula heißt übersetzt auch kleine Glocke und beschreibt die Form der Blüten. Die Blütezeit der Rundblättrigen Glockenblume geht von Mai bis Oktober. Bestäuber sind Bienen wie die Furchenbienen, Masken- und Schmalbienen aber auch Hummeln und Falter. Die Glockenblumen-Scherenbiene ist ein Spezialist und geht nur an Glockenblumen. Die Rundblättrige Glockenblume ist auch eine schöne Pflanze für Steingärten und Mauerkronen. Sie kommt mit jedem Gartenboden zurecht.
Das Wiesenschaumkraut, botanisch bekannt als Cardamine pratensis, ist eine einheimische, wintergrüne und robuste Staude von außergewöhnlicher ökologischer und ästhetischer Bedeutung. Es wächst bevorzugt auf feuchten, nährstoffreichen Böden und fühlt sich an sonnigen bis halbschattigen Standorten besonders wohl. Mit einer Wuchshöhe von 10 bis 40 cm zeigt die Pflanze einen aufrechten, krautigen Habitus, der durch ihre feingliedrigen, grün gefiederten Blätter ergänzt wird. Von April bis Juni begeistert das Wiesenschaumkraut mit seinen zarten, kreuzförmigen Blüten in einem reizvollen blasslila Farbton, die in traubigen Blütenständen angeordnet sind und einen eindrucksvollen Frühlingsteppich in Wiesen und Gärten schaffen können.
Das Wiesenschaumkraut ist nicht nur ein landschaftlich schöner Blickfang, sondern auch von bedeutendem ökologischen Wert. Es dient als wichtige Nahrungsquelle für verschiedenste Tierarten. Insgesamt 45 Wildbienenarten, darunter 7 spezialisierte, nehmen Nektar oder Pollen der Pflanze auf, ebenso wie 5 Schmetterlingsarten und deren Raupen, 5 Schwebfliegenarten und 9 Käferarten. Obwohl sein Nektar- und Pollenwert mit jeweils 1/4 als gering eingestuft wird, erweist es sich durch seine spezifische Eignung als Futterpflanze als unverzichtbar für das Überleben vieler Arten im frühen Jahresverlauf. Besonders der seltene Aurorafalter (Anthocharis cardamines) ist eng mit dieser Pflanze verbunden, da seine Raupen sich hiervon ernähren. Zusätzlich ist das Wiesenschaumkraut durch seine frostresistenten Eigenschaften, mit einer Kältetoleranz bis zu -34°C, eine ideale Bereicherung für naturnahe und bestäuberfreundliche Gärten.
Sein bevorzugter Standort sind feuchte Wiesen, Uferzonen von Teichen und anderen Wasserläufen oder humusreiche Gartenbereiche. Es ist eine ideale Wahl für natürliche Gartengestaltungen, bei denen es als Unterpflanzung oder in großen Gruppen seine harmonische Wirkung entfaltet. Dabei ist es erstaunlich pflegeleicht, da weder spezifische Schnittmaßnahmen noch intensive Pflege erforderlich sind.
Über seine ökologische Rolle hinaus ist das Wiesenschaumkraut auch kulinarisch und medizinisch interessant. Die jungen Blätter vor der Blüte eignen sich hervorragend als würzige Zutat in Salaten, Kräuterquark oder Pestos. Sein kresseartiger, leicht würziger Geschmack macht es zu einer beliebten Wildpflanze in der Küche. Zudem enthält das Wiesenschaumkraut wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Senfölglykoside und Bitterstoffe, die es in der Naturheilkunde für Tees zur Unterstützung von Niere und Leber sowie bei Rheuma interessant machen.
Das Wiesenschaumkraut vereint die Schönheit einer klassischen Wildblume und die ökologische Bedeutung einer essenziellen Bestäuberpflanze. Es ist ein eleganter Frühjahrsbote, der mit seiner natürlichen Anmut und Funktionalität Gartenfreunde und Naturschützer gleichermaßen begeistert. Durch seine vielseitigen Anwendungen und geringe Ansprüche bietet es jedem outdoor-begeisterten Gärtner die Möglichkeit, ein Stück nachhaltige Biodiversität in den heimischen Garten zu bringen.
Der Gewöhnliche Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) ist eine mehrjährige krautige Pflanze mit einem aufrechten Stängel und gelb gefärbten verwachsenen Kronblättern. Seine Blüten stehen in einer Rispe und sind fünfzählig. Die Pflanze produziert ein Öl, um Insekten anzulocken, was besonders für drei Wildbienenarten von Interesse ist. Für die Verbreitung der Samen sorgen der Wind und vorbeistreifende Tiere. Der Gewöhnliche Gilbweiderich ist auch essbar und kann in verschiedenen Gerichten wie Saft und Smoothies verwendet werden. In der Pflanzenheilkunde wurde er früher bei verschiedenen Krankheiten verabreicht, aber heute wird er selten verwendet. Der Gilbweiderich ist ungewöhnlich, da sie Insekten mit Öl und nicht mit Nektar anlockt. Drei Wildbienenarten und 14 Schmetterlingsarten nutzen die Pflanze, um Pollen und Nahrung für ihre Raupen zu sammeln. Besonders die Wald-Schenkelbiene ist auf die Pflanze angewiesen, da sie das Öl mit Pollen vermengt und es in ihren Hosen an den Hinterbeinen sammelt. Die Pflanze ist auch bei der Zippammer, einem Vogel, beliebt, der beim Picken an den Kapseln Samen verteilt. Der Gewöhnliche Gilbweiderich kann durch seine Ausläufer fleißig wuchern und wird oft in der Nähe mittelalterlicher Bauerngärten gefunden.
Der Ufer-Wolfstrapp, auch bekannt als Lycopus europaeus, ist eine Wildstaude, die in ganz Europa, Teilen von Westasien und Ostamerika vorkommt. Sie bevorzugt Standorte im oder am Wasser und ist aufgrund ihrer Verwendung in der Pflanzenheilkunde als sanftes Mittel bei Schilddrüsenüberfunktionen bekannt.
Die Pflanze ist mit kleinen, quirlständigen, weißen Lippenblüten ausgestattet, die in den Blattachsen sitzen und von Schwebfliegen besucht werden. Die Blätter dienen auch als Raupenfutterpflanze und bieten so Nahrung und Lebensraum für Schmetterlingsraupen und Bienen.
Die Ufer-Wolfstrapp bildet zahlreiche Ausläufer und wuchert stark, weshalb sie mit wuchsstarken Pflanzpartnern kombiniert werden sollte. Sie gedeiht am besten in Feuchtgebieten, aber auch in ausreichend feuchten Staudenbeeten und Rabatten in sonnigen bis schattigen Lagen.
Die Wildstaude hat nicht nur eine medizinische Verwendung, sondern ist auch ein wertvolles Element in der Biodiversität. Sie dient als Nahrungsquelle und Lebensraum für Bienen und Schmetterlingsraupen, insbesondere für die spezialisierte Frühe Ziest-Schlürfbiene (Rophites algirus), die sich auf den Pollen und/oder Nektar der Ufer-Wolfstrapp spezialisiert hat. Aber auch die Raupen der Wegerich-Erdeule oder der Messingeule nutzen den Ufer-Wolfstrapp als Futterpflanze. In unserem Webshop bieten wir Ihnen die Ufer-Wolfstrapp an, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Garten- oder Balkonlandschaft mit einer Pflanze zu bereichern, die nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leistet.